Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.
Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zur Schlüsseltechnologie unserer Zeit – mit weitreichenden Vorteilen für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Doch mit der zunehmenden Verbreitung steigt auch die wechselseitige Abhängigkeit: Organisationen und Infrastrukturen in Europa sind auf Anbieter aus aller Welt angewiesen. Die Frage nach digitaler Souveränität rückt in den Fokus: Wie kann künstliche Intelligenz so gestaltet, betrieben und reguliert werden, dass sie von Europas Kulturerbe geprägt ist und europäische Interessen unterstützt?

Künstliche Intelligenz ist zur entscheidenden Zukunftstechnologie geworden. Sie optimiert nicht nur einzelne Prozesse, sondern transformiert ganze Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle. In nahezu allen Branchen – von der Produktion über den Handel bis hin zur Verwaltung – zeigt sich das enorme Potenzial intelligenter Systeme, die lernen, sich anpassen und mit Menschen zusammenarbeiten.
Für Unternehmen ist Künstliche Intelligenz kein Experiment mehr, sondern übernimmt mehr und mehr geschäftskritische Aufgaben, was auch bedeutet, dass Kernbereiche des Unternehmens mit sensiblen Daten, Betriebsgeheimnissen usw. betroffen sind. Dies bringt eine Reihe von Fragen mit sich, z.B. welche Daten außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden sollen, wie Branchenvorschriften (z.B. DORA) eingehalten werden können oder einfach wie individuelle Kontroll- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden können.
Doch trotz wachsender Nachfrage zeigen Daten der Europäischen Kommission, dass im Jahr 2024 nur 13,5 % der europäischen Organisationen KI eingeführt hatten. In Deutschland lag der Anteil ähnlich niedrig bei rund 15 % der Unternehmen.1 Darüber hinaus stammen die meisten führenden KI-Anbieter weltweit nicht aus Europa. Das hinterlässt eine deutliche Lücke – nicht nur bei der Nutzung der Vorteile von KI, sondern auch bei der Gestaltung einer Zukunft, in der KI aus und innerhalb Europas entwickelt wird.
Europas Innovationsgeschichte und sein wertebasierter Technologieansatz eröffnen hier ein strategisches Zeitfenster. „KI ist und bleibt Europas große Chance – und es ist entscheidend, dass wir definieren, was wir unter souveräner KI verstehen“, sagt Matthias Biniok, Leader Client Engineering bei IBM. Wer KI-Systeme nach eigenen Standards und Regeln integriert, sichert nicht nur Vertrauen und Rechtssicherheit, sondern auch technologische Autonomie – und die wird in einer zunehmend geopolitisch geprägten Weltwirtschaft zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
Souveräne KI muss mehr sein als ein politisches Schlagwort. In der Praxis beschreibt sie die Fähigkeit von Unternehmen und Institutionen, ihre KI so zu betreiben, dass sie mit ihren strategischen, rechtlichen und ethischen Zielen im Einklang steht. Es geht nicht darum, sich vollständig von globalen Märkten abzukoppeln, sondern um die bewusste Wahrung der Wahlfreiheit.
Führungskräfte müssen sich fragen: Können wir die Infrastruktur, auf der unsere KI läuft, kontrollieren und anpassen? Welche Transparenz gibt es bei den Trainingsdaten, und können wir unsere eigenen Daten sicher einbringen? Besteht die Gefahr einer Abhängigkeit von bestimmten Anbietern? Oder können wir Technologien bei Bedarf ohne Unterbrechung austauschen?
Hilfreich ist es, auf drei Dimensionen zu fokussieren:
Diese technische Unabhängigkeit schafft Freiraum für Innovation, weil Unternehmen eigene Prioritäten setzen können, statt sich technologisch vereinnahmen zu lassen.
In der Realität zeigt sich ein gemischtes Bild. Viele öffentliche Einrichtungen und Großunternehmen – insbesondere im Banken- und Verwaltungssektor – verfügen über eigene Rechenzentren, strenge Datenrichtlinien und ausgeprägte Governance-Strukturen. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich, dass ein großer Teil der technologischen Infrastruktur auf Lösungen internationaler Hyperscaler setzt. Auch im Bereich der KI-Modelle ist Europa oft auf externe Anbieter angewiesen.
Der Wunsch nach Kontrolle kann dabei in Konflikt mit pragmatischen Zwängen wie Verfügbarkeit, Innovationstempo oder Kostenstrukturen geraten, was manche Organisationen dazu bringt, Kontrolle gegen Flexibilität einzutauschen.
Genau hier setzt das Konzept der „kalkulierten Unabhängigkeit“ an. Matthias Biniok spricht von einem dynamischen Souveränitätsverständnis: „Es geht nicht darum, alles selbst zu entwickeln. Wettbewerbsvorteil bedeutet, jederzeit entscheiden zu können, wie und womit man arbeitet – frei und ohne Abstriche bei Auswahl oder Wirkung.“
Damit gewinnt Interoperabilität an Bedeutung: Offene Standards, modulare Plattformarchitekturen und die Möglichkeit, KI-Systeme bei Bedarf zwischen Clouds oder lokalem Hosting zu migrieren, werden zu entscheidenden Differenzierungsmerkmalen. Souveränität heißt also nicht Abschottung, sondern Transparenz und Beweglichkeit. Prinzipien, die zunehmend regulatorisch gefordert und technologisch gefördert werden.

Ein eindrucksvolles Beispiel für souveräne KI in der Praxis liefert die deutsche Justiz. Im Zuge der Dieselgate-Klagen stand das Oberlandesgericht Stuttgart vor einer beispiellosen Flut an Dokumenten: komplexe Gutachten, juristische Schriftsätze und umfangreiche Akten mussten in kürzester Zeit geprüft und eingeordnet werden. Die vorhandenen Ressourcen reichten kaum aus.
Gemeinsam mit IBM entwickelte das Land Baden-Württemberg die KI-Lösung OLGA – eine Plattform zur intelligenten Unterstützung richterlicher Arbeit. Die Technologie analysiert Dokumente, erkennt Zusammenhänge und bereitet relevante Informationen strukturiert auf. Die Entscheidungshoheit bleibt dabei vollständig beim Menschen – OLGA fällt keine Urteile, sondern schafft Orientierung und Effizienz.
Aktuell läuft OLGA in der IBM Cloud in Frankfurt. Dank der watsonx-Plattform besteht jedoch die Möglichkeit, OLGA oder andere justiznahe Anwendungen auch komplett lokal, in einer abgeschotteten („air-gapped“) Umgebung zu betreiben. Zum Einsatz kommen Open-Source-Modelle, deren Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind.
Das Projekt diente nicht nur der Effizienzsteigerung, sondern setzte neue Standards für Transparenz, Datenschutz und technische Eigenständigkeit. Für viele weitere Bereiche – von Verwaltung über Gesundheitswesen bis zur Industrie – wird OLGA damit zum Vorbild.

Lange galt Regulierung in der digitalen Wirtschaft als Innovationshemmnis. Komplexe Compliance-Auflagen, die Bürokratie öffentlicher Institutionen oder die vielzitierte Trägheit staatlicher Prozesse. All das wurde oft als Bremse für Fortschritt dargestellt. Doch in einer Welt, in der KI zunehmend in sensible Entscheidungsprozesse vordringt, werden Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und rechtliche Klarheit zu entscheidenden Faktoren, um Akzeptanz für diese transformative Technologie zu schaffen.
Mit ihrer KI-Verordnung setzt die Europäische Union einen neuen globalen Standard. Sie definiert klare Anforderungen an Transparenz, Risikobewertung, Nachvollziehbarkeit und Datensicherheit. Für Matthias Biniok ist das kein Widerspruch zur Innovationskraft: „Diese Vorgaben sind kein Bremsklotz. Richtig umgesetzt können sie zum Motor der Innovationskraft der Branche werden.“
IBM zeigt in zahlreichen Projekten, wie sich regulatorische Anforderungen nahtlos mit technischer Exzellenz verbinden lassen. Compliance wird nicht als Belastung verstanden, sondern als Gestaltungsprinzip: integriert in die Systemarchitektur, automatisiert durch intelligente Prozesse und abgesichert mit modernsten Sicherheitsstandards. So hat Europa die Chance, seine Werte nicht nur zu verteidigen, sondern in wirtschaftlichen Erfolg zu übersetzen. Wer heute vertrauenswürdige KI entwickelt, wird morgen weltweit gefragt sein.
Der Aufbau eines erfolgreichen KI-Systems beginnt nicht mit der Technologie, sondern mit der Strategie. Entscheidungsträger:innen müssen sich darüber im Klaren sein, welche Ziele sie verfolgen, welche Prozesse KI unterstützen soll und wie sich ein entsprechendes System in die bestehende Infrastruktur integrieren lässt. IBM empfiehlt dafür einen methodischen Ansatz, der sowohl technische als auch organisatorische Fragen berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht die Client Engineering Methodik: In interdisziplinären Teams entwickeln Unternehmen gemeinsam mit IBM konkrete Anwendungsfälle, testen diese und bringen sie iterativ bis zur Produktionsreife. Die Geschäftsziele werden dabei regelmäßig überprüft und präzisiert.
Der Fokus liegt auf Skalierbarkeit, Integration und Nachhaltigkeit. Die zentrale Frage lautet stets: Wo entsteht tatsächlich Mehrwert – und wie lässt er sich messen? Die Praxis zeigt: Viele KI-Projekte scheitern nicht an der Technik, sondern an unklaren Zielen, schlechter Datenqualität oder mangelnder Akzeptanz im Unternehmen. Souveräne KI braucht deshalb Führung und den Mut, Prozesse grundlegend neu zu denken.
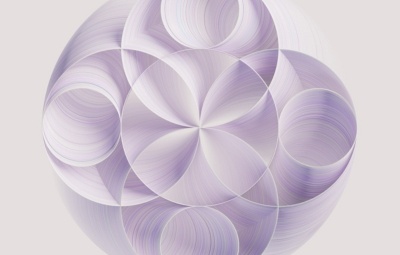

Technologische Exzellenz allein reicht nicht aus, um im globalen KI-Wettbewerb zu bestehen. Es braucht einen Ansatz, der Technologie mit Verantwortung verbindet – und genau hier liegt Europas Stärke. Mit dem Fokus auf Datenschutz, Transparenz, sprachliche und kulturelle Vielfalt sowie kluge Regulierung bietet der Kontinent ein stabiles Fundament für langfristig tragfähige KI-Lösungen.
IBM begleitet Unternehmen auf diesem Weg mit einem ganzheitlichen Ansatz – von praxisnaher Beratung über leistungsfähige Plattformen bis hin zu erprobten Methoden wie der Client Engineering Methodik. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Wahl der passenden Technologie, sondern auch ihre sinnvolle Integration in bestehende Strukturen, die Qualifizierung der Teams und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen.
Besonderen Wert legt IBM auf Lösungen, die skalierbar, transparent und zukunftssicher sind. Ob im öffentlichen Sektor, in der Industrie oder in stark regulierten Bereichen wie Finanzwesen oder Gesundheitswesen. IBM versteht sich als Partner für vertrauenswürdige, verantwortungsvolle und leistungsfähige KI.
Europa muss keine Kopie anderer Märkte sein. Es kann eine Alternative bieten: unabhängig, vertrauenswürdig und innovativ. Wenn Unternehmen und Institutionen diese Prinzipien in ihre Technologiepolitik integrieren, entsteht mehr als ein Standortvorteil – es formt ein neues Verständnis von digitaler Souveränität. „Wir haben in Europa nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen“, sagt Matthias Biniok. „Wir haben auch die Technologie. Jetzt gilt es, sie klug und selbstbewusst zu nutzen.“
1 Europäische Kommission: AI Continent Action Plan – Kommunikation der Kommission zur Beschleunigung der KI-Einführung