Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.
Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige
Europa steht vor enormen Herausforderungen – und Deep-Tech-Start-ups können entscheidend zur Lösung beitragen. McKinsey-Analysen zeigen, was nötig ist, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Biotechnologie ist einer der acht Schlüsselsektoren, in denen Deep-Tech-Unternehmen aktiv sind. Foto: Adobe Stock
Europäische Gründer entwickeln eine neue Generation von Quantencomputern, die komplexe Berechnungen mit einem Bruchteil der heute benötigten Energie durchführen können. Der immense Stromverbrauch Künstlicher Intelligenz (KI) ließe sich damit drastisch senken. „Wir brauchen in Europa dringend mehr solcher Deep-Tech-Ansätze – sie können nicht nur weltweite Herausforderungen lösen, sondern zugleich unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern“, betont Markus Berger-de León, Gründungsexperte und Senior Partner beim Beratungsunternehmen McKinsey.
Passend dazu stehen bei der diesjährigen Ausgabe des Digitalpreises „The Spark“, den McKinsey gemeinsam mit dem Handelsblatt verleiht, Gründungsteams im Fokus, die bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte und Lösungen überführen. Gesucht werden visionäre Deep-Tech-Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, deren Innovationen das Potenzial haben, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.
Deep-Tech-Unternehmen sind in acht Schlüsseltechnologien aktiv: Quantencomputing, Künstliche Intelligenz, neue Energietechnologien, Raumfahrt, Robotik, Biotechnologie, neue Materialien und Verteidigungstechnologien. Während Europa den Boom verbraucherorientierter Tech-Innovationen im Wettbewerb mit dem Silicon Valley und China weitgehend verpasst hat, bietet sich nun die Chance, bei Deep Tech eine führende Rolle einzunehmen. Anders als klassische Tech-Start-ups erfordern diese Unternehmen jedoch oft jahrelange Forschung und hohe Investitionen, bevor marktfähige Produkte entstehen und im Markt skalieren. „Für Investoren ergeben sich bei Deep-Tech außergewöhnliche Renditechancen“, erklärt Berger-de León.

Tatsächlich haben europäische Deep-Tech-Fonds in den vergangenen Jahren eine durchschnittliche Netto-Rendite von 16 Prozent erzielt – und damit klassische Tech-Fonds deutlich übertroffen. McKinsey-Partner und Experte für Start-up-Ökosysteme Tobias Henz führt das auf die langfristige Marktattraktivität zurück: „Die Skalierung ist oft schwieriger, aber wenn sie gelingt, sind die Märkte gigantisch.“ Zudem sichern Patente technologische Alleinstellungsmerkmale und begrenzen den Wettbewerb.
So arbeitet das Münchner Start-up Isar Aerospace an der Entwicklung kostengünstiger, flexibler Trägerraketen, die Satelliten ins All bringen und damit die Grundlage für eine unabhängige europäische Raumfahrt schaffen sollen. Fortschritte in der Antriebstechnologie und Fertigung sollen den Zugang zum Weltraum deutlich effizienter machen. Ein anderes Beispiel ist das Start-up Cylib, das an der Rückgewinnung wertvoller Materialien aus Lithium-Ionen-Batterien arbeitet. Es baut eine Industrieanlage im nordrhein-westfälischen Dormagen, die ab 2027 rund 30.000 Tonnen Altbatterien jährlich recyceln soll.
Doch trotz solcher Innovationen fehlt es Deep-Tech-Gründern in Europa häufig an Kapital. „Der lange Zeithorizont bis zur Kommerzialisierung, die kapitalintensive Forschung und das hohe technologische Risiko schrecken klassische europäische Wagniskapitalgeber oft ab“, erklärt Henz. Und selbst wenn nicht, seien sie häufig zu klein, um die nötigen Investitionen zu stemmen. Viele europäische Deep-Tech-Firmen werden deshalb von nicht-europäischen Investoren finanziert.
Auch regulatorische Hürden bremsen bisher die Kommerzialisierung. „Natürlich müssen ethische Standards und Sicherheitsregeln eingehalten werden – doch oft verhindern überkomplexe Genehmigungsprozesse den Markteintritt und die -skalierung“, kritisiert Henz. Besonders bei Zukunftstechnologien wie Quantencomputing oder Biotechnologie verzögern fehlende einheitliche EU-Regulierungen die Skalierung.
Dabei könnte Deep Tech zum neuen europäischen Wachstumsmotor werden. „Unsere klassischen Industrien wie der Automobilbau stehen vor der Herausforderung, ihre Innovationskraft neu entfachen zu müssen. Deep Tech bietet die Chance, diesen Rückstand aufzuholen“, betont Henz. Jenseits des reinen Wirtschaftswachstums geht es dabei auch um technologische Unabhängigkeit.
In der Energieversorgung könnte Europa durch die Kernfusion oder auch grünen Wasserstoff unabhängiger von geopolitischen Krisen werden. Quantenverschlüsselung könnte kritische Infrastrukturen besser vor Cyberangriffen schützen. Und in der Raumfahrt braucht die EU eine eigene Alternative zu den US-amerikanischen Space-Tech-Unternehmen, um nicht dauerhaft auf US-Startkapazitäten angewiesen zu sein. Nicht nur birgt diese Abhängigkeit erhebliche sicherheitspolitische Risiken beim Transport von Spionage- und Aufklärungssatelliten, sie gefährdet auch die Entwicklung kommerzieller Anwendungen, die durch Daten aus dem All besser werden.
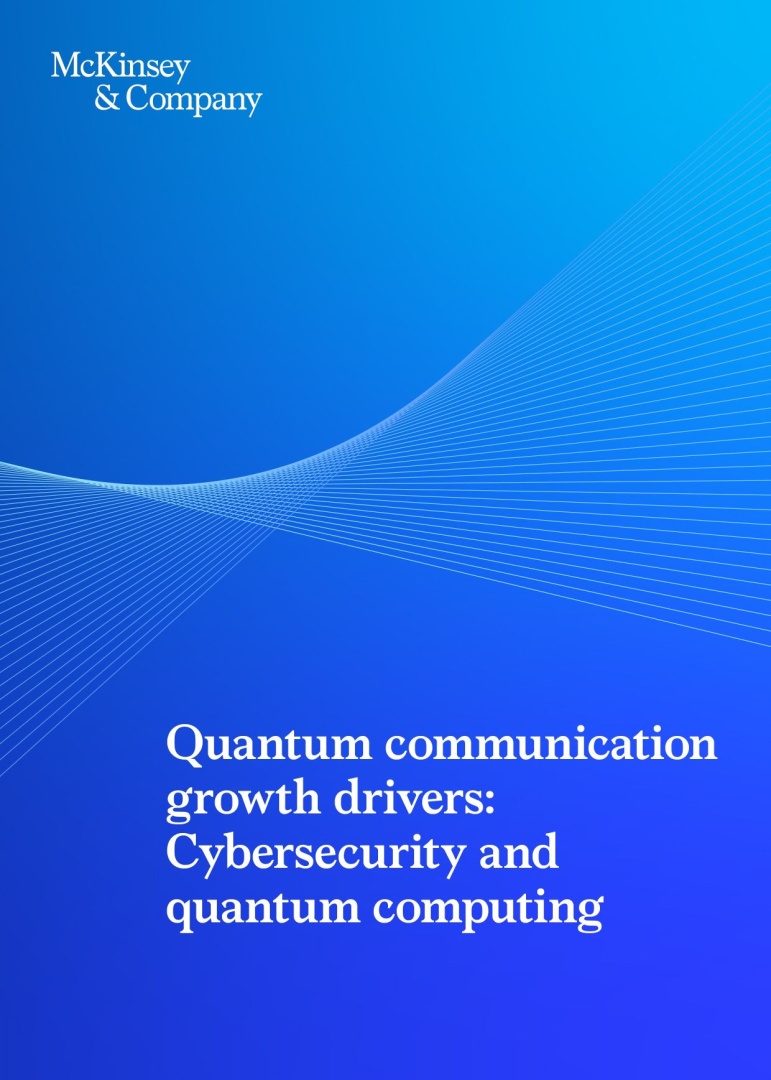
Um Deep Tech in Europa voranzutreiben, braucht es entschlossene Maßnahmen. Eine McKinsey-Analyse schlägt eine Kombination aus weniger Bürokratie, besseren Finanzierungsinstrumenten und auch gezielter staatlicher Förderung vor.
Henz sieht darüber hinaus strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Start-ups und Industrie als entscheidend an: „Etablierte Konzerne können beispielsweise helfen, Hardware zu skalieren – was ein Start-up oft nicht allein schafft.“ Eine Win-Win-Situation, denn Traditionsunternehmen, etwa aus dem Automobilbereich, könnten durch Kooperationen mit Deep-Tech-Gründern ihre Innovationsfähigkeit zurückgewinnen und neue Umsatzpotenziale erschließen.
Europas Deep-Tech-Zukunft hängt entscheidend vom Gründergeist ab – und hier liegt enormes Potenzial. „Wir sollten ihn noch stärker fördern“, betont Henz. Er setzt sich dafür ein, unternehmerisches Denken gezielt in technische und naturwissenschaftliche Studiengänge zu integrieren. Denn: „Erfolgreiche Deep-Tech-Gründer sind der Schlüssel, um unsere technologische und wirtschaftliche Zukunft aktiv zu gestalten.“