Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.
Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige


Von André Braun, Head of DACH, GitLab
Die KI-Revolution ist in vollem Gange. Vor etwas mehr als einem Jahr erhielten Unternehmen und Verbraucher quasi über Nacht Zugang zu KI-Funktionen, die zuvor ausschließlich Datenwissenschaftler:innen vorbehalten waren. Seither betrachten viele Unternehmen KI jedoch vorwiegend als schnelle Lösung für bestehende Herausforderungen wie Probleme im Kundenservice, Fachkräftemangel oder geringe Produktivität. Doch das greift zu kurz – ein allzu bekanntes und irreführendes Denkmuster!

Versetzen wir uns zurück an den Beginn der COVID-19-Pandemie, als weltweit Büros geschlossen wurden. Einige Unternehmen und Führungskräfte waren gut auf den Wechsel zur Remote-Arbeit vorbereitet, viele andere jedoch nicht. Die Unternehmen, die sich erfolgreich an die neuen Gegebenheiten anpassen konnten, waren diejenigen, die ihre Prozesse und Technologien schnell hinterfragten, um reibungslose Arbeitsabläufe unabhängig vom Standort zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu stolperten jene Unternehmen, die sich weniger bewusst mit dieser neuen Arbeitsrealität auseinandersetzten und es versäumten, Prozesse zur Förderung informeller Kommunikation und Unternehmenskultur zu etablieren, durch hybride Meetings – nur um ihre Mitarbeitenden schließlich doch wieder ins Büro zu holen.
Heute stellt die KI-Revolution Führungskräfte und Softwareentwicklungsteams vor eine ähnliche binäre Entscheidung: Betrachtet man KI als vorübergehenden Hype, der lediglich kurzfristige Bedürfnisse stillt, nur um sie wieder aufzugeben, bevor ihr volles Potenzial entfaltet ist? Oder nutzt man die Chance, die KI bietet, um die eigene Arbeitsweise grundlegend zu überdenken? Die Antwort auf diese Frage liegt in den Händen der Softwareentwicklungsteams!
KI beschleunigt die Demokratisierung im Technologiebereich und verändert bestehende Arbeitsweisen – und Softwareentwickler:innen stehen dabei im Mittelpunkt dieses Wandels. Viele Entwickler:innen fürchten zwar die Auswirkungen von KI auf ihre Karriere, doch gleichzeitig haben sie erheblichen Einfluss darauf, wie die KI-Revolution in der Praxis gestaltet wird. Ihre Rolle entwickelt sich von der reinen Code-Erstellung hin zu einem stärkeren strategischen Einsatz von KI-Tools. Entwickler:innen mit entsprechender Ausbildung können sich dann auf Bereiche wie Softwarearchitektur, Qualitätskontrolle oder Leistungsoptimierung konzentrieren, anstatt nur Fehler zu beheben.
Leiter von Entwicklungsteams, die das Potenzial von KI voll ausschöpfen wollen, sollten ihre Mitarbeitenden ermutigen, eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung ihrer Coding-Praktiken einzunehmen. Darüber hinaus sollten sie ihre Teams dazu anregen, sich bewusst und strategisch mit der Integration von KI in ihre Arbeitsabläufe auseinanderzusetzen.

Trotz aller Vorteile müssen Softwareentwicklungsteams Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und mit Bedacht einsetzen. Unternehmen, die auf den Einsatz von KI in der Softwareentwicklung verzichten, riskieren, schnell ins Hintertreffen zu geraten. Umgekehrt laufen Manager, die unüberlegt und übereilt KI implementieren, Gefahr, ein hohes Risiko für vergleichsweise geringen Nutzen einzugehen.
Eine fehlerhafte Implementierung kann Unternehmen erheblichen Risiken aussetzen, wie Sicherheitslücken, Strafzahlungen, den Verlust von Kunden oder Reputationsschäden, wenn sie nicht sorgfältig prüfen, wie KI-Tools sensible Unternehmens-, Kunden- und Partnerdaten speichern und schützen. Wenn wertvolles geistiges Eigentum nach außen gelangt oder Sicherheitslücken ausgenutzt werden, können die Folgen für ein Unternehmen sogar existenzbedrohend sein. Deshalb muss die Unternehmensführung ein Umfeld schaffen, in dem strategische Diskussionen über den Einsatz von KI zur Norm werden.
Ein guter Ansatzpunkt ist es, den Austausch zwischen Technikern, Juristen und KI-Dienstleistern zu fördern und gemeinsam Fragen zu erörtern wie:
- Welche Large Language Models (LLMs) treiben die KI-Funktionen in unserer Plattform an?
- Wer hat die Kontrolle und den Zugang zu den LLMs?
- Wer behält die geistigen Eigentumsrechte an den in KI-Systeme eingegebenen Inhalten?
- Wer ist Eigentümer der von KI-Systemen erzeugten Ergebnisse (oder Vorschläge)?
- Wo platzieren wir die Bedingungen, Richtlinien und Verpflichtungen, die die Nutzung unserer KI-Funktionen regeln?
Darüber hinaus geht es bei diesen Gesprächen nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften; sie können auch die Zukunft eines Unternehmens auf einem wettbewerbsorientierten Markt sichern. Künstliche Intelligenz erfordert eine Neudefinition der Erfolgsmetriken: weg von tätigkeitsbezogenen Kennzahlen wie der Anzahl geschriebener Codezeilen, hin zu differenzierteren Werten wie der Verbesserung der Problemlösungsfähigkeit und der Verkürzung der Markteinführungszeit.
Gute Softwareentwicklung bedeutet nicht nur, mehr Code schneller zu produzieren, sondern vor allem, Probleme möglichst effizient zu lösen. Die Integration von KI in den Entwicklungsprozess – etwa zur Unterstützung beim Refactoring von Code oder der Dokumentation – spart Entwickler:innen Zeit, reduziert die kognitive Belastung bei der Lösung komplexer Aufgaben und bietet sowohl Unternehmen als auch Endnutzern einen deutlich höheren Mehrwert.
Eine kürzlich von GitLab durchgeführte Studie ergab, dass 55 % der CXOs die Messung der Produktivität als entscheidend für den Unternehmenserfolg ansehen. Dennoch gaben über die Hälfte der Befragten an, dass ihre Methoden zur Messung der Produktivität von Entwicklungsteams entweder fehlerhaft sind oder sie nicht wissen, wie sie diese sinnvoll erfassen können. Die drei T's (Task, Time und Team) sind ein passendes Modell, um zu beurteilen, ob es den Entwickler:innen gelingt, ein Gleichgewicht zwischen der Produktionssteigerung und der Qualitätssicherung zu finden.
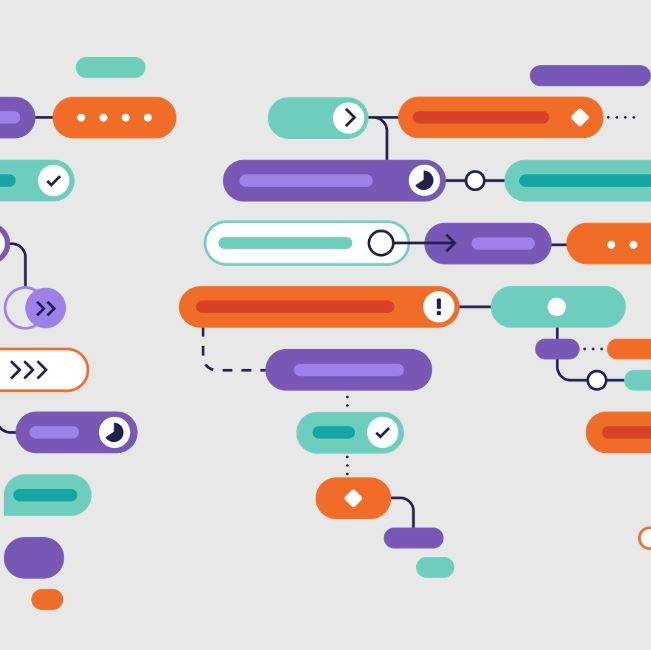
Letztendlich kommt man nicht darum herum, das Erledigen von Aufgaben zu messen. Ebenso entscheidend ist jedoch, dies im Verhältnis zum benötigten Zeitaufwand zu betrachten – und zwar nicht nur in Bezug auf die Gesamtprojektdauer, sondern durch eine ganzheitliche Analyse der gesamten Entwicklungspipeline. Dazu zählen etwa die Häufigkeit von Code-Bereitstellungen, die Dauer der Vorbereitungszeit vor Änderungen und die Geschwindigkeit, mit der ausgefallene Dienste wiederhergestellt werden. Auf diese Weise lassen sich gezielt Bereiche zur Prozessoptimierung identifizieren.
Darüber hinaus sollten auch teambezogene Metriken erfasst werden. Wie stark unterstützen sich Entwickler:innen gegenseitig? Wie ist das Arbeitsklima? Wie engagiert sind die Mitarbeitenden, und wie gut funktioniert die Zusammenarbeit im Team? Diese Fragen sind zentral, um die Mitarbeiterfluktuation zu verringern, was wiederum die Effizienz des gesamten Teams steigert. All diese Faktoren sind essenzieller Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses.
Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist der Einfluss auf das Unternehmen selbst. Wie dieser definiert wird, hängt von Branche, Projekt und Anwendung ab. Ein Team kann zwar produktiv sein, aber Ergebnisse liefern, die keinen positiven Effekt auf das Unternehmen haben. Daher ist es wichtig, die Ziele der Entwicklungsteams mit den übergeordneten Unternehmenszielen zu verknüpfen. Es ist entscheidend, Erfolge messbar zu machen, und hier müssen Manager und Entwickler:innen eng zusammenarbeiten, um die Produktivität der Teams und das Engagement der Mitarbeitenden in Einklang zu bringen. Außerdem sollte die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsteams und anderen Abteilungen des Unternehmens aktiv gefördert werden.
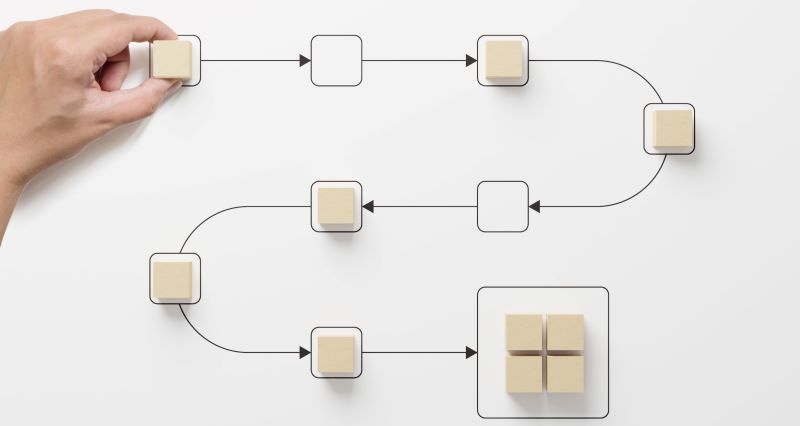
Die effiziente Implementierung von KI in Unternehmen erfolgt nicht auf Knopfdruck. Entwicklungsteams benötigen eine Testphase, um herauszufinden, wie KI und andere Tools in die spezifischen Arbeitsabläufe integriert werden können. Kurzfristig kann dies zu Produktivitätseinbußen führen, bevor langfristige Vorteile sichtbar werden – darauf sollte die Unternehmensführung vorbereitet sein.
Wie sollte man also die Implementierung von KI im eigenen Unternehmen angehen? Entwicklungsteams sollten zunächst risikoarme Bereiche identifizieren, in denen KI nachweisbare Vorteile bieten kann. Mit wachsender Erfahrung und besserem Verständnis der Leistungsfähigkeit und Grenzen der KI kann der Einsatz schrittweise ausgeweitet werden. Der Schlüssel zur Optimierung der Softwareentwicklung liegt in der kontinuierlichen Bewertung und Anpassung von KI-Tools und Algorithmen, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Nutzen liefern.
Während dieser Entwicklungs- und Iterationszyklen sollte die Unternehmensführung für Transparenz und Rechenschaftspflicht sorgen. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten verstehen, wie KI-Tools eingesetzt werden, welche Datenquellen und Modelle ihnen zugrunde liegen und welche potenziellen Verzerrungen oder Einschränkungen bestehen.

Von der Pandemie bis zur KI-Revolution: In den letzten Jahren standen Unternehmen vor großen Umbrüchen. Doch wer bereit ist, Neues zu lernen und sich anzupassen, findet in solchen Revolutionen stets auch Chancen zur Weiterentwicklung. Oft eröffnen sich dadurch effizientere Arbeitsweisen und Möglichkeiten zur Problemlösung, die zuvor undenkbar schienen.
Das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz bringt sowohl enorme Chancen als auch Ungewissheiten mit sich. KI kann die Softwarequalität verbessern, die Markteinführungszeit verkürzen und die Produktivität der Entwickler:innen steigern, während gleichzeitig die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Kund:innen wächst. Doch KI birgt auch Risiken, die vielen Unternehmen oft nicht bewusst sind. Nicht nur fürchten insbesondere Entwicklungsteams, durch KI ersetzt zu werden, sondern sie sehen sich auch gezwungen, ihre Arbeitsabläufe anzupassen und ihre Komfortzone verlassen zu müssen.
Die Erfahrungen mit der Umstellung auf Remote-Arbeit haben uns auf diesen Moment vorbereitet. Wer die Lehren der Pandemie auf die KI-Revolution anwendet, reagiert nicht nur auf den Wandel, sondern gestaltet ihn aktiv mit und positioniert seine Teams und Unternehmen an der Spitze technologischer Innovation. Wenn wir KI mit der gleichen Begeisterung und Entschlossenheit angehen, die uns geholfen hat, den Übergang zur Remote-Arbeit erfolgreich zu meistern, werden wir auch in einer technologiegetriebenen Zukunft weiterhin führend bleiben.