Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.
Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige
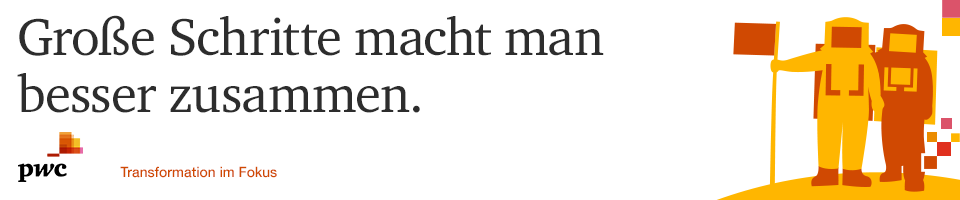
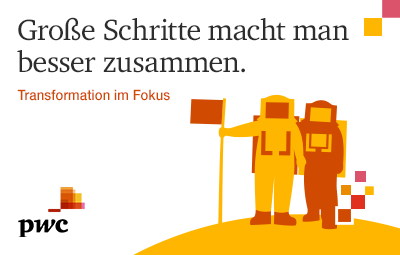
Lesedauer 4:02
Die Globalisierung macht es möglich: Über 8,5 Millionen 40-Fuß-Container* werden allein im Hamburger Hafen jedes Jahr verladen. Lieferketten sind heute internationaler als jemals zuvor – rund 80 Prozent des Welthandels basieren auf globalen Wertschöpfungsketten. Alles im Einklang mit den geltenden Bestimmungen? Mitnichten. Einem Bericht der Bundesregierung (Herbst 2021) zufolge kommen rund 80 Prozent der in Deutschland ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ihrer Sorgfaltspflicht in puncto Lieferketten bisher unzureichend nach.

(Bild: Unsplash)

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Chance für mehr Resilienz und Vertrauen
Laden Sie sich jetzt das Whitepaper zum LkSG herunter und erfahren Sie wie das Gesetz in fünf Projektphasen umgesetzt werden kann.
Konkret bedeutet dies, dass globale Lieferketten zum Teil gravierende menschen- und umweltrechtliche Risiken aufweisen – und dagegen wird nicht genug unternommen. Wie aktuelle Zahlen der Bundesregierung zeigen, sind weltweit etwa 79 Millionen Mädchen und Jungen von ausbeuterischer Kinderarbeit betroffen. Das Problem: Oftmals fehlt auch hiesigen Unternehmen das Bewusstsein dafür, wie stark Unternehmen als Kollektiv Einfluss auf die Veränderung dieser verheerenden Missstände haben. Eine Tatsache, die kaum mit den oftmals strengen ESG-Kriterien und dem Selbstbild moderner Unternehmen vereinbar ist. Der Gesetzgeber hat reagiert: So wird am 1. Januar 2023 das sogenannte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Deutschland in Kraft treten – ein Wortungetüm mit wichtiger Botschaft.
Wir haben mit Dr. Jan Herrmann von PwC Deutschland gesprochen – darüber, was das neue Gesetz für handelstreibende Unternehmen bedeutet. Und über die Frage, wie die Verordnung dazu beitragen kann, die Transparenz der Lieferketten zu erhöhen und Menschenrechte zu stärken – und dabei gleichzeitig die Unternehmensinteressen an Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen berücksichtigt.
Der PwC-Experte ist überzeugt: Wer sich intensiv mit seiner Lieferkette sowie den Aktivitäten der Geschäfts- und Vertragspartner beschäftigt und transparent darüber informiert, kann nicht nur bei Kunden und Partnern punkten, sondern sich auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen – ein konsistentes Supply Chain- und Risikomanagement ist dabei unerlässlich.
Herr Dr. Herrmann, das neue Gesetz soll Unternehmen aufzeigen, wie es um die Einhaltung von Menschen- und Umweltrechten in ihren globalen Lieferketten steht. Sicher ist, dass Kinder- und Zwangsarbeit, ein mangelnder Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie umweltbelastende Praktiken immer noch ganz reale Probleme darstellen. Aus Ihrer Erfahrung: Sind den meisten Unternehmen diese Probleme überhaupt bewusst? Und wenn ja – warum wurde bis dato so wenig getan?
Dr. Jan Joachim Herrmann
Partner, Procurement & Sustainable Supply Chain bei PwC Deutschland
Dr. Jan Herrmann: Ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein bei den Unternehmern vorhanden ist. Die offensichtliche Frage ist allerdings, ob sie ihren Handlungsspielraum auch richtig einschätzen. Die Steuerung der länderübergreifenden Lieferketten, Wertströme und finanziellen Strukturen liegt in ihrer Hand. Und damit auch die Möglichkeit, viel direkter auf die Verteilung von Gütern und finanziellen Mitteln Einfluss zu nehmen als beispielsweise der national-handelnde Staat („America first“) oder das lokal durchgriffsbeschränkte Individuum selbst.
Klar ist, dass kein Unternehmen im Alleingang die Welt retten kann. Probleme wie Zwangs- und Kinderarbeit lösen wir nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt – und zwar im Kollektiv.
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ermöglicht genau das. Auch wenn es auf viele Unternehmen zunächst regulatorischen Druck ausübt, gelingt uns erst so die notwendige Gemeinschaftsleistung, um nachhaltige Strukturen für unsere Zukunft zu schaffen: Die Umsetzung und Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten wird im Kollektiv letztendlich auch „bezahlbar“ – weltweit und auch auf nationaler sowie europäischer Ebene.
„Die Lieferkettenoptimierungen sind der entscheidende Hebel, um Menschenrechtsverletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden.“
Deutsche Unternehmen haben noch bis Januar 2023 Zeit, ihre globalen Wertschöpfungsketten zu prüfen und die gesetzlichen Pflichten umzusetzen. Andernfalls drohen empfindliche Strafen. Ist das Timing aus ihrer Sicht realistisch? Wo fange ich als kleines Unternehmen an?
Dr. Jan Herrmann: Ich halte das Zeitfenster für angemessen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ihre Methoden bis zum 1. Januar 2023 so weit angepasst haben, dass sie ab 2023 insbesondere ihr Risikomanagement umsetzen können. Dafür ist es wichtig, schon jetzt Strukturen und Risikoanalysen zu etablieren, zu wissen, wie Workflows funktionieren sollen und welche Tools im Einsatz sind. Konkret sollten sich Unternehmen in diesem Kontext anschauen, welche Fähigkeiten sie bereits haben und worauf sich aufsetzen lässt – denn oft ist dabei weniger Aufwand nötig als gedacht. Schließlich beschäftigen Unternehmen häufig Mitarbeitende, die sich schon sehr lange und intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen – ein Potenzial, das sich sehr gut nutzen lässt.
Das neue Gesetz ist auch international von hoher Bedeutung. Deutsche Unternehmen und Tochterunternehmen ausländischer Firmen in Deutschland, die ihre Prozesse und Abläufe nicht an die bevorstehenden Gesetzesänderungen anpassen, gehen ein hohes finanzielles und reputationsbezogenes Risiko ein. Können Sie die Dimensionen dieser Risiken kurz skizzieren?

Workshop-Reihe: LkSG – Gemeinsam fit
Die Expert:innen von PwC Deutschland haben für betroffene Unternehmen eine Roadmap und eine Aufgabenstruktur für die neun Sorgfaltspflichten ausgearbeitet. In den regelmäßigen Sessions helfen sie Ihnen dabei, die Vorgaben Schritt für Schritt in die Praxis umzusetzen. Zudem sind Sie Teil einer Community, in der Sie Herausforderungen und Fortschritte mit Vertreter:innen anderer Unternehmen kontinuierlich teilen und so voneinander lernen können.
Dr. Jan Herrmann: In der Tat sind die im gesetzlichen Strafkatalog hinterlegten Sanktionen drakonisch – Unternehmen müssen bis zu acht Millionen Euro zahlen, wenn die durch den Gesetzgeber geforderten Präventionsmaßnahmen nicht etabliert sind. Darüber hinaus können weitere Strafzahlungen folgen, wenn es an anderen Stellen ebenfalls Defizite gibt – eine Obergrenze existiert nicht. Die empfindlichen Strafen werden unter anderem verhindern, dass Unternehmen möglicherweise lieber die Zahlungen in Kauf nehmen, als entsprechende Maßnahmen zu realisieren. Eine zivilrechtliche Verfolgung spielt bis dato noch keine Rolle – ist allerdings von Seiten der EU bereits gefordert. Es kann sehr gut sein, dass Deutschland hier in einer späteren Version des Lieferkettengesetzes nachziehen wird.
Das Reputationsrisiko ist bei Verstößen allerdings deutlich wichtiger – dafür sorgt die geforderte Transparenz in den Lieferketten, die dem Endverbraucher tiefe Einblicke gewähren wird. Wir werden nicht mehr quartalsweise von Hiobsbotschaften unserer Lieblingsmarken überrascht, sondern wöchentlich, wenn die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden. Und von einem können wir ausgehen: Die NGOs sowie der Regulator und die Kunden selbst werden die Informationen rasant verbreiten. Das ist reputationstechnisch eklatant. Verbraucher werden solche Produkte künftig nicht mehr kaufen wollen und die Unternehmen in den sozialen Medien an den Pranger stellen. Meine Erwartung ist, dass die finanziellen Risiken bei Gesetzesverstößen im Vergleich zum Verlust der Reputation fast schon eine untergeordnete Rolle spielen.
„Es gibt keine ethische oder finanzielle Alternative zur Einhaltung von Menschenrechten.“
Transparenz ist ein wichtiges Stichwort. Viele Unternehmen setzen in diesem Zusammenhang auf externe Expertise und intelligente Lösungen, die ihnen einen vollumfänglichen Überblick über ihr Nachhaltigkeits-Ökosystem liefern und bestenfalls Schwachstellen schnell aufdecken. Welche Tools unterstützen Unternehmen bei der Identifikation von menschen- und umweltrechtlichen Risiken in unserer weltweiten Wertschöpfungskette?
Dr. Jan Herrmann: Grundsätzlich sehen wir drei wichtige Faktoren, die es bei der Implementierung einer digitalen Lösung zu beachten gilt: Erstens muss das Tool in der Lage sein, einen Risiko-Funnel abzubilden. Damit können Unternehmen, Lieferanten nach den schwerwiegendsten inhärenten und konkreten Risiken bewerten. Diese Risikopriorisierung werden Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette vornehmen müssen, um die Komplexität zu lösen.
Zweitens muss die Interoperabilität mit bestehenden Lieferantenkollaborationssystemen gewährleistet sein, um das Tool beispielsweise an die Lieferantenbasis oder an einen Lieferanten-Fragebogen- bzw. ein Reporting-Tool anzudocken. Entscheidend ist, diesen Prozess integrativ zu meistern.
Drittens: Unternehmen müssen sich Gedanken machen, wie sie interne und externe Informationen miteinander verknüpfen und bewerten. Denn am Ende gilt es, aus der Masse der Datenpunkte die richtigen Informationen zu ziehen, und diese wiederum mit dem richtigen Scoring zu versehen
Die Systeme und Lösungen entwickeln sich in allen drei Bereichen rasant weiter. Dieser Technologie-Schub ist ein wichtiges Zeichen dafür, wie viel die Kollektivleistung tatsächlich bewirken kann. Denn durch die große Nachfrage wird viel in die Tool-Entwicklung investiert – und das kommt wiederum allen zugute.
Stichwort Risikomanagement: Mehr Transparenz bei den menschen- und umweltrechtlichen Risiken der Lieferkette bietet auch neue Perspektiven auf Themen wie Versorgungssicherheit, Innovation, Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Risiken. Wie gelingt es den Verantwortlichen, diese Risiken zu bewerten?

Webcast-Reihe – LkSG: Risikoanalyse und Vorstellung unserer LkSG-Software
In unserem September-Webcast stellen Ihnen unsere Expert:innen die wesentlichen Elemente einer Risikoanalyse im Sinne des LkSG vor sowie die Anforderungen, die bei der Umsetzung zu beachten sind. In unserem Webcast im Oktober haben Sie die Möglichkeit, unsere für das LkSG entwickelte Software „Check Your Value Chain” kennenzulernen. Mit unserer cloudbasierten Applikation können Sie die Risiken in Ihren Lieferketten identifizieren, bewerten und mitigieren, um den gesamten Anforderungen aus dem LkSG gerecht zu werden und sie in einem systemischen End-to-End-Prozess abzubilden.
Dr. Jan Herrmann: Hier stoßen wir auf eine methodischen Herausforderungen. Zwar gibt das Gesetz schon einige Bemessungsparameter vor, aber die Unternehmen müssen daraus eine konsistente, handhabbare und logische Bewertungsstruktur ableiten und diese auf komplexe Lieferantenstrukturen anwenden – das ist alles andere als trivial.
Herausfordernd sind dabei insbesondere die verschiedenen Dimensionen, die Unternehmen bewerten müssen. Eine menschen- oder umweltrechtliche Bewertung kann nicht durch eine stabile finanzielle Situation kompensiert werden – das heißt, ein Unternehmen kann einen Low Score bei Kinderarbeit nicht durch einen High Score bei Koalitionsfreiheit ausgleichen. Konkret bedeutet das: Weg von der klassischen Balanced Scorecard, hin zu einer neuen Bewertungsmethodik, die vorhandene Dimensionen in die richtige Reihenfolge bringt. Unternehmen sollten sich also das Risikoprofil plus den relevanten Angemessenheitskriterien ihrer Lieferanten ansehen und daraufhin die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen treffen.
Tritt trotz aller Bemühungen der Ernstfall ein, geht es um schnelle Schadensbegrenzung. Was müssen Unternehmen tun, wenn Verstöße in der Wertschöpfungskette bekannt werden?
Dr. Jan Herrmann: Zunächst einmal gilt es zu prüfen, ob bereits Abhilfemaßnahmen für solche Szenarien existieren und man möglicherweise auf einen Standardprozess ausweichen kann – oder ob neue Maßnahmen oder Regeln benötigt werden, um die Herausforderung so schnell wie möglich zu lösen. Entsprechende Regelwerke müssen für alle Beteiligten transparent sein und klar vorgeben, was bei welcher Eskalationsstufe zu unternehmen ist. Gerade wenn Risikobewertungen für vermeintlich unersetzliche Lieferanten negativ ausfallen, agieren viele Unternehmen übereilt.
Ein Lieferantenwechsel steht in aller Regel an letzter Stelle. Werden Schwachstellen erkannt, gibt es viele alternative Abhilfemaßnahmen. Entscheidend ist, dass Unternehmen durch ihre Möglichkeiten – seien es Medienanalysen, makroökonomische Informationen oder Audits – Risikovorfälle erkennen und bestenfalls vermeiden. Auch der Informationskanal bzw. die -kaskade ist dabei wichtig, sodass Unternehmen im Ernstfall schnell informiert sind.
Was ist Ihr persönliches Fazit?
Dr. Jan Herrmann: Insgesamt bin ich davon überzeugt, dass das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz für uns als Gesellschaft, aber auch für jedes Unternehmen, eine große Chance darstellt. Wir alle profitieren von der Transparenz, die schlussendlich Vertrauen schafft und dazu beiträgt, dass sich unsere Wirtschaft nachhaltig entwickelt. Unternehmen, die sich bei der Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und der Transparentmachung von Prozessen Unterstützung wünschen, können sich gerne an das PwC-Team wenden. Mehr Insights rund um das Thema Sustainable Supply Chain und das LkSG finden Sie auch auf unserer Webseite: https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/sustainable-supply-chain.html
Herzlichen Dank für das Gespräch!
*Quelle: Port of Hamburg, Abruf 03.05.2022